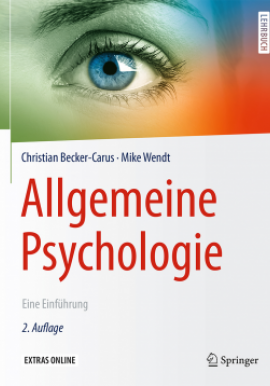Inhaltsübersicht
Kapitel 1: Psychologie als Wissenschaft
Kapitel 2: Neurowissenschaft und Verhalten – biologisch-physiologische Grundlagen
Kapitel 4: Auditorisches System und weitere Wahrnehmungssysteme
Kapitel 5: Aufmerksamkeit und Bewusstsein
Kapitel 10: Denken, Problemlösen, Entscheiden
Kapitel 1: Psychologie als Wissenschaft
Nach einem allgemeinen Einstieg und kurzen historischen Rückblenden in das Arbeitsfeld der Allgemeinen Psychologie, die ihren Ausgangspunkt in der Philosophie hatte, für die ihre Ergebnisse heute wieder von großem Interesse sind, wird auch das alte Leib-Seele-Problem aus alter und neuer Sicht betrachtet. Ausgehend von den unterschiedlichen Schulen des 19. Jahrhunderts und einer derzeitigen Definition der Allgemeinen Psychologie als Wissenschaft, die sich mit den allgemeingültigen Gesetzmäßigkeiten des Erlebens und Verhaltens von Organismen, speziell des Menschen, sowie deren Ursachen und Wirkungen befasst, werden fünf der unterschiedlich vertretenen Konzepte und Perspektiven, die in der Allgemeinen Psychologie eine Rolle spielen, umrissen und charakterisiert. Eingehender dargestellt werden: Der biologisch-neurophysiologische Ansatz, der behavioristische Ansatz, der kognitionspsychologische Ansatz, der psychoanalytische Ansatz, der subjektivistische (phänomenologische) Ansatz und das jüngere Aufkommen der kognitiven Neurowissenschaften. Unter dem Titel: >Psychologie als wissenschaftliche Forschungsmethode< wird erörtert: Wie stellt man die richtigen Fragen? Wie findet man die richtigen Antworten? Und wie bewertet man deren Gültigkeit? Dazu werden diskutiert: Einstellungs- oder Erwartungseffekte, der Overconfidence-Effekt, sowie der Rückschaufehler. Dargestellt wird der Weg, wie kommt man von der einfachen wissenschaftlichen Fragestellung zur Hypothesen- und Theoriebildung. Angesprochen wird das Bilden von Theorien mit Beobachtungshypothese, Experimenteller Hypothese, Nullhypothese, die Forderung nach Überprüfbarkeit und Objektivität, sowie die Regeln der Beweisführung und das Vorgehen bei induktiven und deduktiven Schlüssen. Als Methodische Prinzipien der Psychologie werden behandelt: Objektivität und Standardisierung (mit Operationalen Definitionen und Objektiver Registrierung) sowie Reliabilität und Validität. Im Abschnitt >Methoden der Versuchsplanung und Datenerhebung< wird ein Überblick über die folgenden, in der wissenschaftlichen Psychologie gebräuchlichsten Verfahren gegeben: Kernstück der experimentellen Methode ist das kontrollierte Experiment, um den Zusammenhang zwischen mehreren Variablen zu prüfen und bestehende kausale Abhängigkeiten aufzudecken. Dabei sind unabhängige Variablen Faktoren im Experiment, die manipuliert werden und deren Wirkung untersucht wird. Die Abhängige Variable ist der Faktor im Experiment, der gemessen und dessen Abhängigkeit untersucht wird. Mit statistischen Korrelationsverfahren lassen sich wissenschaftliche Aussagen über das Ausmaß (die Stärke) des Zusammenhanges zwischen je zwei Variablen machen. Korrelationen erlauben aber keine Rückschlüsse auf die Richtung (Kausalität) des Zusammenhanges. Als Datenerhebungsverfahren werden besprochen (1) verschiedene Beobachtungsmethoden (2) Befragungsmethoden mit direkten, indirekten und geschlossenen Fragen. Hierbei spielt die Fragebogenkonstruktion mit den Gütekriterien von Objektivität, Reliabilität und Validität eine wichtige Rolle. Hinzu kommen als weiteres indirektes und retrospektives Erhebungsverfahren die Fallstudien. Psychologische Tests sind ein gängiges und wichtiges Datenerhebungsverfahren. Es dient zur Messung psychologisch bedeutsamer Merkmale oder Eigenschaften mit dem Ziel einer quantitativen Bestimmung der untersuchten Merkmalsausprägung. Auch hier gelten die Hauptgütekriterien von Objektivität, Reliabilität und Validität.
Kapitel 2: Neurowissenschaft und Verhalten – biologisch-physiologische Grundlagen
All unser psychisches und kognitives Erleben und Handeln ist aufs engste verknüpft mit der Integration einer Vielzahl verschiedenster physiologischer Prozesse in unserem Körper, wobei dem Nervensystem für die Informationsübertragung und -verarbeitung eine besondere Bedeutung zukommt.
Die Informations- oder Erregungsleitung im Nervensystem ist ein elektrochemischer Prozess, der sich an den und in den Nervenzellen (Neuronen) abspielt. Unterschieden werden sensorische, motorische und Inter-Neurone. Wird ein Neuron durch einen Reiz stimuliert, kommt es über eine lokale Depolarisation der Zellmembran bei Überschreitung eines jeweils bestimmten Schwellenwertes zur Auslösung eines Aktionspotenzials. Solche lösen an den Synapsen die Freisetzung von Neurotransmittersubstanzen aus, die in dem postsynaptischen Neuron zu EPSPs oder IPSPs führen, deren summative Verrechnung bei Überschreiten einer Auslöseschwelle zur Entstehung eines weitergeleiteten Aktionspotenzials führt (Nervenimpuls). Die chemischen Codierungssysteme an den Synapsen des neuronalen Netzwerkes sind äußerst komplex und werden an Beispielen einiger Neurotransmitter (Acetylcholin, Dopamin, Serotonin, Adrenalin, GABA sowie Opiaten und Endorphinen) erörtert. Das Nervensystem der Wirbeltiere gliedert sich in das Zentralnervensystem (ZNS) und das periphere Nervensystem (PNS), mit unterschiedlichen afferenten und efferenten Bahnen. Auch das PNS besteht aus zwei Teilen, (1) dem somatischen (SN oder animalischen) und (2) dem autonomen (ANS oder vegetativen) Nervensystem. Letzteres umfasst zwei weitgehend antagonistisch zueinander arbeitende Untersysteme: (1) das sympathische und (2) das parasympathische Nervensystem. Das neuroendokrine System (neuro- und innersekretorischen Hormondrüsen) bewirkt eine wesentlich langsamere und indirekte Steuerung und Kontrolle der Aktivität verschiedenster Bereiche und Organe des gesamten Körpers – einschließlich des Nervensystems. Es ist insofern auch in Teilen mitverantwortlich für unser psychisches Erleben (bei Stress, Übererregbarkeit, Sexualverhalten). Eine der wichtigsten endokrinen Drüsen ist die Hirnanhangdrüse (Hypophyse), die als Teil des Gehirns zusammen mit dem Hypothalamus. eine zentrale Schaltstelle zwischen den Funktionen des Gehirns, dem autonomen Nervensystem und dem endokrinen System bildet. Neurosekretorische Zellen im Hypothalamus produzieren, angeregt durch Nervenimpulse, die sogenannten Freisetzungs- oder Releasing-Hormone. Hierzu gehört das in der Hypophyse gebildete adrenocorticotrope Hormon (ACTH), das zusammen mit dem entsprechenden Releasing-Hormon, dem CRH, in das Hypothalamus-HypophysenNebennierenrinden-System (kurz als HHN-System) eingebunden ist. Dies als funktionale „Achse“ bezeichnete Regelkreissystem wird genauer besprochen. Dargestellt wird die Struktur, Lage und phylogenetische Entwicklung der Gehirnanteile, nach der ältere und neuere Strukturen mit unterschiedlichen Funktionen unterschieden werden. Ausführlicher werden die spezialisierten Rindenfelder (Cortex Areale) betrachtet, motorischer Cortex, somatosensorischer Cortex, auditorischer Cortex, visueller Cortex, und die Assoziationsareale. Untersuchungen an Patienten mit definierten Hirnschädigungen haben zu wichtigen Einsichten in die strukturellen Voraussetzungen des kognitiven und verbalen Lernens sowie des Bewusstseins geführt. So reagieren Split-Brain-Patienten (im Test), als hätten sie zwei unabhängige Gehirne mit eigenem Bewusstsein, eigenen Erinnerungen, Fähigkeiten und auch eigenen Emotionen. Cerebrale Lateralisation bezeichnet die unterschiedliche Funktion beider Hirnhemisphären. Die linke hat vor allem die sprachlichen Fähigkeiten und kann komplizierte logische und analytische Tätigkeiten vollbringen. Die rechte Hemisphäre hat dagegen ein hoch entwickeltes räumliches Vorstellungsvermögen und ein weit besseres visuelles Wahrnehmungsvermögen. Im Abschnitt Genetik und Verhalten werden die Grundprinzipien der Vererbung, die Mendelschen Gesetze, die Wirkung unterschiedlicher Erbfaktoren (Gene) auf die Merkmalsausprägung bei homozygoten und heterozygoten Organismen umrissen. Bei der als Mitose bezeichneten Zellteilung mit identischer Reduplikation bleibt der normal doppelte oder diploide Chromosomensatz erhalten. Bei der Reduktionsteilung (Meiose), aus der die Keimzellen (Eizellen oder Spermien) hervorgehen, werden die Chromosomenpaare geteilt so dass jede Keimzelle nur den halben (haploiden) Chromosomensatz erhält. Es werden Chromosomenbau und Molekulargenetik, dazu die Rolle von DNA und RNA, besprochen. Im Abschnitt Vererbung, Umwelt und Verhaltensgenetik wird die Bedeutung und Reichweite der Erbe-Umwelt-Frage erörtert, die Frage des genetischen Potenzials, der begrenzten Prädisposition und die Selektive Zuchtwahl, die auch für intellektuelle (kognitive) Fähigkeiten nachgewiesen wurde. Abschließend werden dazu auch Ergebnisse der Zwillingsforschung vorgestellt.
Kapitel 3: Wahrnehmung
Wahrnehmung basiert auf der Verarbeitung von an den Rezeptororganen aufgenommenen Reizenergien. Die verschieden Sinnesmodalitäten werden in spezialisierten Hirnarealen verarbeitet. Die (äußere) Psychophysik stellt Zusammenhänge zwischen dem Wahrnehmungsinhalt und dem zugehörigen distalen Reiz her. Verschiedenartige Messverfahren der Empfindungsstärke haben zur Formulierung unterschiedlicher Funktionen geführt. In der Signalentdeckungstheorie werden zusätzlich Antwortkriterien der wahrnehmenden Personen berücksichtigt. Über die Netzhäute aufgenommene visuelle Informationen werden entlang der Sehbahn in den visuellen Cortex fortgeleitet. Bereits in der Netzhaut kommt es zum Phänomen der Kontrastverstärkung durch laterale Hemmung. Neurone des visuellen Systems weisen rezeptive Felder auf, die mit zunehmendem Abstand zum Rezeptororgan auf immer kompliziertere Reizereignisse reagieren. Im visuellen Cortex herrscht eine retinotope und merkmalsspezifische Repräsentation vor. Farbwahrnehmung beruht auf den Aktivierungsmustern der drei für unterschiedliche Wellenlängen sensitiven Zapfen der Netzhaut. Auf nachgelagerter Ebene herrscht eine antagonistische Verschaltung vor, welche zum Phänomen der Gegenfarb-Komplexe Rot-Grün und Blau-Gelb führt. Zur Abschätzung der Entfernung von Gegenständen greift das visuelle System auf diverse Tiefenhinweise zurück, die teils der Netzhaut eines einzelnen Auges entnommen werden können und teils auf dem Vergleich der Netzhautbilder beider Augen (Querdisparation) beruhen. Die wahrgenommene Größe von Objekten wird unter anderem durch die wahrgenommene Entfernung bestimmt. Reizmerkmale wie Größe, Form oder Helligkeit werden trotz deutlicher Veränderungen des zugehörigen proximalen Reizes oftmals als stabil wahrgenommen (Wahrnehmungskonstanz). Die Strukturierung sensorischer Information erfolgt anhand verschiedener Prinzipien der Gestaltbildung. Das Erkennen von dreidimensionalen Objekten basiert möglicherweise auf der Identifikation elementarer Teilkörper und wird durch Faktoren des situativen Kontexts beeinflusst. Die Wahrnehmung von Bewegung geht mit negativen Nacheffekten einher. Scheinbewegungen ergeben sich bei Darbietung leicht veränderter Bilder in rascher Abfolge. Bei der Konstituierung eines spezifischen Bewegungseindrucks bei den ambigen Reizvorlagen spielen Heuristiken eine bedeutende Rolle.
Kapitel 4: Auditorisches System und weitere Wahrnehmungssysteme
Das auditive System vermittelt die Wahrnehmung von Schallwellen, die sich in Begriffen von Lautstärke, Tonhöhe und Klangfarbe beschreiben lässt. Die Umwandlung der Druckschwankungen des äußeren Mediums in neuronale Impulse erfolgt nach der Aufnahme über das Trommelfell und Weiterleitung über das Mittelohr in der Hörschnecke des Innenohres. Hier kommt es zu einer Zerlegung des anliegenden Schalls in Bestandteile unterschiedlicher Frequenz. Über die Hörbahn erfolgt eine Weiterleitung in den auditorischen Cortex, in welchem eine tonotope Organisation sowie mit größer werdendem Abstand vom Rezeptororgan eine zunehmende Spezialisierung der Neurone auf spezifische Lautkategorien vorherrscht. Zur Lokalisation von Schallquellen werden interaurale Unterschiede in der Schallintensität und Reizeinsatzzeit herangezogen. Die Strukturierung der akustischen Reizumgebung beruht auf verschiedenen Gruppierungsprinzipien. Geruchswahrnehmung basiert auf der Stimulation von Rezeptorzellen in der Riechschleimhaut. Verschiedene Geruchsqualitäten werden vermutlich durch das Muster der durch einen Riechstoff aktivierten Rezeptorzellen codiert. Geschmackswahrnehmung basiert auf der Stimulation von Rezeptorzellen auf der Zunge und in der Mundhöhle und lassen sich auf fünf Grundqualitäten reduzieren. Die taktil-haptische Wahrnehmung beruht auf vier verschiedenen Rezeptortypen. Die aufgenommenen Druck- und Berührungsinformationen werden im somatosensorischen Cortex in
somatotoper Form repräsentiert, wobei die Größe der einzelnen Bereiche mit der Sensibilität der entsprechenden Körperregionen korreliert. Aktive Exploration geht oftmals mit überlegenen Erkennensleistungen einher. Selbstverursachte Berührungen werden aufgrund des Reafferenzprinzips als weniger stark empfunden. Neben der Verarbeitung von Druck- und Berührungsreizen existieren Systeme zur Erzeugung von Temperatur- und Schmerzempfindungen sowie zur Erfassung der Position der Körperglieder. Simultane Reize verschiedener Sinnesmodalitäten können zugehörige Wahrnehmungen wechselseitig beeinflussen. Die Stärke des Einflusses von einer Modalität auf eine andere ist von diversen Faktoren abhängig.
Kapitel 5: Aufmerksamkeit und Bewusstsein
Nur ein geringer Ausschnitt der zu jedem Zeitpunkt an den Sinnesorganen anliegenden Reizinformation wird beachtet. Man spricht auch davon, dass Aufmerksamkeit auf diese Reize gerichtet wird. Diese Reizinformationen erhalten eine hervorgehobene oder bevorzugte Verarbeitung, zum Beispiel im Sinne der Bewusstwerdung oder der Verwendung zur Steuerung von Handlungen. Beachtete Reize rufen bereits in einer frühen Verarbeitungsphase stärkere Reaktionen in sensorischen Gehirnarealen hervor. Auch nicht zu beachtende Reize werden jedoch oftmals in gewissem Ausmaß kognitiv verarbeitet und semantisch entschlüsselt. Hierdurch ergeben sich Interferenzeffekte bei der Reaktion auf handlungsrelevante Reize. Aufmerksamkeit kann auf spezifische Orte in der Reizumgebung, aber auch auf nicht-räumliche Merkmale oder Reizdimensionen gerichtet werden. Die Beachtung eines Merkmals eines Objekts führt zur bevorzugten Verarbeitung auch anderer Merkmale desselben Objekts. Die Ausrichtung der Aufmerksamkeit wird durch das Zusammenwirken von Top-down- und Bottom-up-Prozessen gesteuert: Zum einen erfolgt die Reizselektion intentionsgeleitet, d. h. anhand der aktuellen Verhaltensziele. Zudem sind allerdings bestimmte Reizereignisse in der Lage, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, wenn hierfür eine begünstigende Einstellung vorliegt. Top-down- und Bottom-up-Effekte werden durch unterschiedliche Hirnstrukturen vermittelt. Der Begriff Bewusstsein wird in diversen Bedeutungen verwendet. Eine oftmals verwendete Bedeutung bezieht sich auf den Erlebnischarakter mentaler Repräsentationen, welcher sich von außen nicht beobachten lässt (phänomenales Bewusstsein). Untersuchungen zum phänomenalen Bewusstsein befassen sich mit Veränderungen des Wahrnehmungseindrucks, die sich ohne zugehörige Reizveränderung ergeben. Veränderte Bewusstseinszustände können auf diverse Weisen hervorgerufen werden und sich auf verschiedene Aspekte des Bewusstseins beziehen. Für die allgemeine Wachheit und Reaktionsbereitschaft des Organismus spielt die Formatio reticularis eine herausgehobene Rolle. Beim Schlafen werden verschiedene Stadien zyklisch durchlaufen, welche mit charakteristischen physiologischen Veränderungen einhergehen. Im Laufe eines Nachtschlafes vermindert sich die Dauer der Tiefschlafphasen, während sich die Dauer der REM Phasen erhöht. Eine wichtige Funktion des Schlafes besteht vermutlich in der Gedächtniskonsolidierung.
Kapitel 6: Handlungssteuerung
Handlungen werden danach unterschieden, ob zur Ausführung der zugehörigen Bewegung sensorisches Feedback genutzt wird (Closed-Loop-Kontrolle), oder ob die Bewegung unabhängig von ihren sensorischen Effekten in einer zuvor festgelegten Form abläuft (Open-Loop-Kontrolle). Belege für Planungsprozesse von Handlungen finden sich inForm verzögerter Initiierung von komplizierteren gegenüber einfachen Bewegungen sowie von Beschleunigungen des Bewegungsbeginns durch die Spezifikation von Bewegungsparametern im Vorfeld. Das Auftreten diverser Antizipationseffekte (Beeinflussungvon Teilhandlungen durch die Beschaffenheit von im Anschluss durchzuführenden weiteren Handlungsschritten) belegt zudem die mentale Vorwegnahme von späteren Handlungsmerkmalen zu einem früheren Zeitpunkt. Dissoziationen zwischen der bewussten Wahrnehmung und Handlungssteuerung bei hirngeschädigten Patienten wie auch bei gesunden Versuchspersonen legen nahe, dass visuelle Reizinformationen in unterschiedlicher Weise zur perzeptuellen Erfassung wie Größen- oder Orientierungsschätzung auf der einen und der Steuerung von Greifhandlungen auf der anderen Seite verarbeitet werden. Bestimmte Zuordnungen von Reizen zu Reaktionen lassen sich leichter realisieren als andere; ein besonders deutlicher Effekt ist die Überlegenheit von Handlungen unter Bedingungen räumlicher Korrespondenz zwischen Auslösereiz und Reaktion (räumliche Reiz-Reaktions-Kompatibilität). Die Durchführung von Handlungen geht mit der Antizipation ihrer sensorischen Konsequenzen einher. Der ideomotorischen Hypothese zufolge basiert die Initiierung von Willkürhandlungen auf derartigen Effektantizipationen. Die Bearbeitung zeitlich überlappender Aufgaben führt zu Leistungseinbußen, zu deren Erklärung diverse Vorschläge gemacht wurden. Oftmals wird angenommen, dass eine begrenzte Verarbeitungsressource durch den simultanen Zugriff im Rahmen zweier verschiedener Aufgabenbearbeitungen überlastet wird, oder dass ein bestimmter Prozess (Flaschenhals) zu einem Zeitpunkt nur voneiner der beteiligten Aufgaben genutzt werden kann. Prozesse der Organisation und Koordination von Aufgaben sowie der Anpassung der Informationsverarbeitung an spezifische Kontextbedingungen zur Optimierung der Bearbeitungsleistung werden als Exekutive Funktionen bezeichnet. Der Wechsel zwischen Aufgaben, welche mit denselben Stimuli durchzuführen sind, geht mit Verhaltenskosten einher, die durch eine Aufgabenvorbereitung reduziert werden können. Aktuelle Modelle der Informationsverarbeitung gehen von einer kontinuierlichen Überwachung der kognitiven Aktivität aus und nehmen an, dass die Detektion kritischer Ereignisse zur Adaptation der Verarbeitungsstrategie führt.
Kapitel 7: Lernen
Im Unterschied zum nichtassoziativen Lernen (z. B. die als Habituation bezeichnete Abschwächung der Reaktion auf einen wiederholt dargebotenen Reiz), beruht assoziatives Lernen auf der Verbindung von Reizen oder von Reizen und Reaktionen. Beim klassischen Konditionieren kommt es zu einer Kopplung zwischen einem US, welcher in reflexhafter Weise eine bestimmte Reaktion (UR) auslöst, mit einem weiteren Reiz (CS), dessen Darbietung ursprünglich nicht zur Auslösung der Reaktion führt. Die kontingent erfolgende gepaarte Darbietung beider Reize führt dazu, dass auch der CS eine Reaktion (CR) auslöst, die der UR zumeist ähnlich ist. Eine wichtige Rolle für das Zustandekommen einer klassischen Konditionierung spielt der (relative) Vorhersagewert, den der CS hinsichtlich des Auftretens des US aufweist. Beim operanten Konditionieren verändert das kontingente Auftreten bestimmter Reize nach einem spezifischen Verhalten dessen Auftretenswahrscheinlichkeit. Bei einer Erhöhung der Auftretenswahrscheinlichkeit wird von Verstärkung gesprochen. Die spezifische Systematik, mittels derer ein Verhalten verstärkt wird (Verstärkerplan), bestimmt die Geschwindigkeit und die Form des Lernverlaufs. Sowohl klassisch als auch operant konditioniertes Verhalten lässt sich löschen, indem die Kopplung von CS und US bzw. von Reaktion und Verstärker aufgehoben wird. In beiden Lernformen treten Phänomene der Reizgeneralisierung und Reizdiskrimination auf. Kognitionspsychologische Erklärungen gehen davon aus, dass Umgebungsbedingungen mental repräsentiert und Erwartungen hinsichtlich des Eintretens bestimmter Reizereignisse gebildet werden. Lernen durch Einsicht wird auf inneres Probehandeln zurückgeführt. Es ermöglicht die plötzliche erstmalige Ausführung umfangreicher Handlungsabläufe. Lernerwerb muss sich nicht unmittelbar im Verhalten zeigen, sondern kann mitunter erst zu einem späteren Zeitpunkt sichtbar werden, z. B. wenn das entsprechende Verhalten eine Bekräftigung erfährt. Man spricht in diesem Fall von latentem Lernen. Beobachtungslernen beinhaltet die Übernahme von an einer anderen Person (Modell) wahrgenommenen Verhaltensweisen. Das Ausmaß des Beobachtungslernens ist von verschiedenen Faktoren abhängig, zum Beispiel von den Konsequenzen des Verhaltens in der Beobachtungssituation und vom Grad der Identifizierung mit dem Modell.
Kapitel 8: Gedächtnis
Beim Zustandekommen einer Gedächtnisleistung lassen sich generell drei Prozessstufen unterscheiden: Codierung (Aufnahme der zu behaltenden Information), Speicherung (Aufbewahren über der Zeit) und Abruf (Zugreifen auf die gespeicherte Information). Erinnerungsbeeinträchtigungen können durch Fehlfunktionen auf jeder dieser Stufen hervorgerufen werden. Gedächtnisleistungen werden zudem oftmals nach der Länge des Zeitraums unterschieden, über welchen Informationen zu behalten sind. Hier lässt sich im Groben eine Einteilung vornehmen in (1) sehr kurzzeitige Nachwirkung von Sinneseindrücken (sensorisches Gedächtnis), (2) eine durch aktives Aufrechterhalten, begrenzte Kapazität und Manipulierbarkeit der bereitgehaltenen Information charakterisierte Repräsentation über Sekunden bis zu mehreren Minuten (Kurzzeit-/Arbeitsgedächtnis) und (3) eine quasi unbegrenzte, strukturierte Form der Aufbewahrung (Langzeitgedächtnis). Ein weiteres Einteilungsschema bezieht sich auf die Inhalte des Gedächtnisses, z. B. deklaratives Faktenwissen und prozedurale Fertigkeiten. Die frühe Gedächtnisforschung hat einige generelle Prinzipien offengelegt, beispielsweise einen negativ beschleunigten, asymptotisch verlaufenden Abfall der Erinnerungsleistung über der Behaltenszeit oder Beeinträchtigungen der Erinnerungsleistung durch das Erlernen zusätzlichen Materials (proaktive und retroaktive Interferenz). Sie hat gezeigt, dass verteiltes Lernen effektiver ist als massiertes Lernen, dass die Wiedererkennungsleistung stets besser ist als die des Reproduzierens. Vorgestellt werden Positionseffekte, Interferenz und Isolierungseffekte. Mit der Methode des teilweisen Berichtens kann gezeigt werden, dass das sensorische Gedächtnis eine weit größere Speicherkapazität besitzt, als man es aus Anwendungen der Methode des vollständigen Berichtens einer kurzzeitig dargebotenen Reizvorlage ableiten könnte. Unterschieden werden hier ikonische und echoische Repräsentation. Die in das Kurzzeitgedächtnis/Arbeitsgedächtnis aufgenommene Information bedarf der kontinuierlichen Auffrischung (rehearsal). Die Speicherkapazität wird unter anderem durch die Möglichkeit der Zergliederung des zu behaltenden Materials in bedeutungsvolle Einheiten (Chunking) bestimmt. Für das Arbeitsgedächtnis wird eine Strukturierung angenommen, die sowohl materialspezifische Speicherkomponenten als auch eine Instanz zur Organisation und Prozesskoordinierung beinhaltet. Diese werden als phonologische Schleife, visuell-räumliche Notizblock, episodischer Puffer und zentrale Exekutive vorgestellt. Der Abruf aus dem Arbeitsgedächtnis erfolgt mittels eines Suchprozesses, der möglicherweise alle Einzelelemente seriell verarbeitet. Die im Langzeitgedächtnis gespeicherte Information zeichnet sich durch einen hohen Grad an struktureller Organisation aus. Sie bedarf offenbar der Konsolidierung über einen längeren Zeitraum. Wichtige Faktoren für erfolgreiches Erinnern finden sich sowohl auf der Stufe der Codierung (Tiefe der Verarbeitung) als auch auf der Stufe des Abrufs (Verfügbarkeit von retrieval cues). Unterschieden werden visuelle und akustische sowie Geruchs- Geschmacks und Tast-Encodierungen. Darüber hinaus ist von Bedeutung die „Passung“ der Prozesse in der Lern- und Abrufsituation (Encodierspezifität). Diverse Dissoziationen von Gedächtnisleistungen lassen die Existenz zweier getrennter Gedächtnissysteme für deklarativexplizites und prozedural-implizites Wissen vermuten. Eine weitere häufige Unterteilung bezieht sich auf semantische vs. episodische Gedächtnisinhalte. Unser konzeptionelles Wissen wird in Form semantischer sowie propositionaler Netzwerke gespeichert. Diese sind hierarchisch strukturiert. Eine klare Strukturierung von Lerninhalten führt zu effektiverer Speicherung und einer besseren Erinnerung. Die verschiedenen Methoden des Abrufs werden vorgestellt sowie Priming- und Kontexteffekte. Als Ursachen des Vergessens werden besprochen: Nichteinprägung, Zerfall. Displacement, Nichtzugängigkeit, sowie emotionale und motivationale Faktoren. Erörtert werden als unterschiedliche Gedächtnistheorien: die Zwei Speicher- Modelle, Theorie der Verarbeitungstiefe und die Theorie des aktivierten Langzeitgedächtnisses. Gedächtnisleistungen stellen in vielen Fällen einen konstruktiven Prozess dar, der mithilfe von weiteren Informationen (z. B. aus allgemeinen Schemata) Erinnerungen hervorbringt. Durch das Einüben von Mnemotechniken lassen sich Gedächtnisleistungen für spezifische Inhalte deutlich steigern. Besprochen werden die Loci- Methode, das Visualisieren, die Methode der Schlüsselbegriffe, die kognitive Elaboration sowie die PQRST-Methode. Die neurobiologische Basis des Gedächtnisses wird durch reverberatorische neuronale Erregungskreise gebildet sowie durch langfristige synaptische Veränderungen (Langzeitpotenzierung). Die wesentliche Komponente der Konsolidierung und Überführung der Lerninhalte in ein Langzeitgedächtnis wird heute in der intrazellulären Proteinbiosynthese (▶ Exkurs 8.45) gesehen.
Kapitel 9: Sprache
Sprache ist eng verknüpft mit unserer Fähigkeit, komplexe Gedanken, Ideen und Vorstellungen auszubilden, zu kommunizieren und zu reflektieren oder auch Emotionen auszudrücken. Sprache kann aus gesprochenen Lauten oder geschriebenen Schriftzeichen bestehen oder auch durch Mimik und Gestik übermittelt werden. Sowohl beim Sprachverstehen als auch bei der Sprachproduktion lassen sich in gleicher Weise drei verschiedene Ebenen unterscheiden: Gedanken-, Satz- und Wörterebene. Als Grundeinheiten der Sprache gelten: Phoneme, Morpheme, Phrasen und Propositionen. Ihr Aufbau und Zusammenhang ist durch Regeln der Grammatik festgelegt. Dazu gehören: Phonologie, Morphologie und Syntax. Die Semantik bezeichnet die Gesamtheit aller Regeln. Bei der Erkennung von Wörtern gibt es das Segmentierungs- und das Variabilitätsproblem; dazu den McGurk-Effekt. Der Worterkennungsprozess wird in der Psycholinguistik häufig in drei Teilprozesse unterteilt: (1) Lexikalischer Zugriff, (2) Lexikale Auswahl (3) Integration der Wortbedeutung in den Kontext. Zum Verlauf der Worterkennung werden drei theoretische Modelle vorgestellt. Bei den Theorien zur auditiven Worterkennung handelt es sich zumeist um interaktive Modelle. Sie unterscheiden sich nun in ihrer Annahme danach, ob der Abruf aus dem mentalen Gedächtnis parallel oder seriell erfolgt. Letztere Annahme war aber nicht haltbar. Beim TRACE-Modell, einem interaktiven Aktivations- und Netzwerkmodell der Worterkennung wird angenommen, dass bei der Worterkennung des gesprochenen/gehörten Wortes Bottom-up und Top-down-Prozesse gleichzeitig und flexibel interagieren, d. h., dass alle zugängigen Informationen gleichzeitig genutzt werden. Die Kohortenmodelle erfordern im Gegensatz zum TRACE-Modell eine genauere Übereinstimmung von Sprachsignal und lexikalischer Repräsentation, wofür bestimmte Grundannahmen gemacht werden, u. A., dass beim Hören initiale Wort-Kohorten gebildet werden, durch die alle anders beginnenden Wörter schon ausgeschieden werden. Dazu wird auch bei diesen Modellen angenommen, dass alle eingehenden Informationen (lexikalische, syntaktische, semantische) parallel verarbeitet werden, aber dass eine top-down Beeinflussung der Kohorte durch Information höherer Ebene (semantischer Kontext) erst auf einem späteren Stadium der Worterkennung erfolgt. Mittlerweile gibt es viel Evidenz dafür, dass Wörter aktiviert werden, bevor eine Kohorte gebildet wird. Das geschieht aber nur dann, wenn der Kontext das Wort sehr vorhersagbar macht. Auch bei den Modellen zur visuellen Worterkennung findet sich die Unterteilung in lexikalischen Zugriff, Selektion und Integration in den Kontext. Die auffälligsten Unterschiede liegen aber in der Informationseingabe, bei der u. A. die ganze Wortinformation gleichzeitig „auf einen Blick“ ersichtlich ist. Bei dem Dual-route-Modell werden grundsätzlich zwei Wege, Pfade, angenommen, die vom gedruckten Wort zum mentalen Lexikon und auch weiter bis zum Aussprechen (Lautlesen) führen: ein direkter und ein indirekter Pfad, bei welchem die Grapheme zunächst in Phoneme übersetzt werden. Bei der Satzverarbeitung und dem Satzverstehen werden strukturell- syntaktisches Wissen (mit Phrasenstrukturregeln), semantisches Wissen und pragmatisches Wissen benötigt. Zur Erklärung werden zwei Modelle der Satzverarbeitung besprochen. Nach dem Garden-Path-Modell (einem der einflussreichsten Erklärungsmodelle) verläuft sie Satzverarbeitung nach einer seriellen und modularen Verarbeitungsstrategie. Beginnend mit dem Strukturaufbau wird jedes weitere Wort sofort in die schon bestehende Struktur integriert, ohne eine erst später erfolgende Bedeutungsanalyse.Die Constraint-based Modelle verarbeiten dagegen von Anfang an alle verfügbaren Informationsquellen zur Entschlüsselung der syntaktischen Satzstruktur (parallele Verarbeitung). In welchem Ausmaß, und ob überhaupt, mehrere Analysen gleichzeitig bearbeitet werden können, ist bis heute umstritten, ebenso, ob die Analyseprozesse auf einer oder mehreren Ebenen (z. B. Syntax und Semantik) ablaufen und ob und inwieweit sie sich dabei gegenseitig beeinflussen. Aufbauend auf dem Garden-Path-Modell wurde ein neurokognitives Stufenmodell des Satzverstehens entwickelt, das verschiedene Teilergebnisse der neueren neuropsychologischen Forschung zusammenfasst. Die bei den Untersuchungen zum Satzverstehen gleichzeitig abgeleiteten Hirnströme im EKP und fMRT-Aufzeichnungen sprechen u. A. dafür, dass der Satzverarbeitungsprozess unmittelbaren Gebrauch von allen relevanten Informationen macht, wie es von den Constraint-based-Modellen angenommen wird. Bei der Textverarbeitung wird unterschieden zwischen der (1) textgesteuerten (bottom-up), und der (2) rezipientengesteuerten (top-down) Verarbeitung. Bedeutsam sind ferner mentale Modelle und bildhafte Vorstellungen. Die der Wortproduktion und Sprachproduktion zugrunde liegenden Prozesse ähneln denen des Sprachverstehens. Sie verlaufen jedoch in umgekehrter Richtung, vom gedanklichen Konzept zur Wortform und der sprachlichen Äußerung. Die gängigen, auf das WEAVER++-Konzept zurückgreifenden Modelle gehen davon aus, dass sich drei globale Funktionsstufen bzw. Ebenen unterscheiden lassen: Konzeptualisierung, Formulierung, Artikulierung. Hinzu kommt der Hörerbezug. Bei der Sprachentwicklung, werden vier Stufen des Spracherwerbs unterschieden: erstes und zweites Lallstadium, Einwort- und Zweiwortstadium. Wichtig beim Erwerb grammatikalischen Wissens sind die kritischen Perioden, die auch beim Bilingualismus von Bedeutung sind, bei dem offenbar parallel zwei Wortformspeicher angelegt werden.
Kapitel 10: Denken, Problemlösen, Entscheiden
Denken umfasst die Erkenntnisakte des Begreifens, Meinens, Schlussfolgerns und Urteilens. Es werden verschiedene Formen des Denkens unterschieden: verbales oder propositionales Denken. Es ist bedeutungsbezogen, gedanklich. Bildhaftes Denken. Es ist mit Vorstellungen verbunden, die wir im Geiste „sehen“ können. Als motorisches Denken wird ein Denken bezeichnet, das eher mit mentalen Bewegungsabläufen korrespondiert. Weiter wird unterschieden zwischen diskursivem (zergliederndem logisch schließendem) und intuitivem (gefühlsartigem, einfallsproduzierendem) Denken. Produktives Denken bezeichnet das Denken, das völlig neue Ergebnisse hervorbringt, wie es bei schöpferischen Menschen zu beobachten ist. Bei der Propositionalen Wissensrepräsentation agieren wir vornehmlich mit Konzepten. Sie repräsentieren jeweils eine ganze Klasse von zum Beispiel Objekten oder Merkmalen, die ihnen durch Kategorisierung zugewiesen sind. Konzepte werden, soweit sie nicht angeboren sind, in der Regel durch Erfahrung erworben. Nach der kritischen Merkmalstheorie wird ein Konzept charakterisiert durch das Vorhandensein von einer genügend großen Anzahl notwendiger Merkmale. Nach der Prototypentheorie wird ein Konzept durch ein prototypisches, repräsentatives Beispiel charakterisiert, das in etwa der zentralen Tendenz der Attribute aller Mitglieder des Konzeptes entspricht. Der exemplarbasierte Ansatz charakterisiert Kategorien als eine Sammlung von Beispielen, die den Prototypeffekt ausmachen. Auch beim Bildhaften Denken und räumlichen Vorstellen gibt es beträchtliche individuelle Unterschiede. Dazu gehören die mentale Rotation, das visuelle Abtasten sowie das Bilden mental-kognitiver Landkarten. Neuronale Basis. Wesentliche Erkenntnisse über die Lokalisation psychischer Hirnfunktionen verdanken wir den Untersuchungen an Patienten mit verschiedenen neurologischen Schädigungen, bei denen recht spezifische Störungen sowohl des bildhaften als auch des semantischen Gedächtnisses zu beobachten waren. So zeigt sich das gleiche Neglect beim realen Wahrnehmen wie beim bildlichen Vorstellen, was dafür spricht, dass die gleichen geschädigten Hirnareale normalerweise für beide Funktionen zuständig sind. Mit modernen bildgebenden Verfahren, wie der Positronen- Emissions-Tomografie (PET), der Magnet-Resonanz-Tomografie (MRT), auch Kernspin-Tomografie oder MRI sowie der funktionalen MRT (fMRT), die dargestellt werden, ließ sich nachweisen, dass sowohl die Wahrnehmungs- als auch die Vorstellungstätigkeit in denselben Arealen des primären visuellen Cortex ablaufen und das Bildvorstellen auf die gleichen frühen Stadien der corticalen Bildverarbeitung zurückgeht, die hier von gespeicherten Bildinformationen aus dem Langzeitgedächtnis aktiviert werden. Schlussfolgerndes, deduktives Denken bezeichnet die Ableitung von Sätzen und Erkenntnissen aus anderen, allgemeineren Sätzen oder vorgegebenen Aussagen (Prämissen, Antecedens) Sie führt zum abgeleiteten Schluss, der Konklusion. Es werden Syllogismen und Venn-Diagramme, die Analyse der Struktur, Regeln der Verknüpfung und die Zuordnung von Wahrheitswerten besprochen.Induktives Denken bezeichnet in der Logik der Schluss, der von einem oder wenigen Fällen (dem Besonderen) auf alle Fälle einer Gesamtheit (das Allgemeine) schließt. Dazu werden die Basis-Raten-Regel (Bayes-Theorem), die Konjunktionsregel der Wahrscheinlichkeitstheorie und die fortschreitende Induktion erörtert. Problemlösen besteht in der Reduktion der Diskrepanz zwischen (1) einem Ausgangszustand und (2) einem Zielzustand, der durch die Lösung erreicht werden soll, und (3) den Operatoren (Regeln, Hilfsmitteln, Schritten), mit deren Hilfe die Diskrepanz überwunden werden kann. Dies kann mittels Versuch-Irrtums-Strategien, zumeist aber durch zielgerichtetes Problemlösen erreicht werden. Zur Auswahl der Operatoren gibt es verschiedene Strategien: Die Methode der Unterschiedsreduktion, die Mittel-Ziel-Analyse und die Rückwärts-Analyse, die besprochen werden. Wichtig dabei ist die passende kognitive Repräsentation und die Verfügbarkeit der Operatoren. Für ihre Anwendbarkeit spielt die Güte der Problemdefinition eine entscheidende Rolle. Entscheiden. Die Struktur von Entscheidungssituationen (unter Sicherheit, unter Unsicherheit oder unter Risiko) wird mithilfe von Entscheidungsbäumen verdeutlicht. Entscheidungstheorien beschreiben, wie rationale Entscheidungen getroffen werden sollten, oder wie Menschen tatsächlich entscheiden. Normative Theorien stellen ideale Regeln für rationale Entscheidungen auf und versuchen, die Gewinnchancen (Nutzen) zu maximieren. Deskriptive Theorien erklären und wollen vorhersagen, wie Menschen tatsächlich Entscheidungen treffen. Hierzu gehören die SEU Theorien und die Beachtung der unterschiedlichen Risikobereitschaft. Prospekt Theorie berücksichtigt die subjektive Verlustaversion, den subjektiven Nutzen wie auch den Framing-Effekt, der den Einfluss irrelevanter Situationsaspekte bezeichnet. Als Phasen des Entscheidungsprozesses werden unterschieden: präselektionale, selektionale und postselektionale Phase. Bei komplexer Entscheidungsfindung kann unbewusstes Denken zu besseren Ergebnissen führen. Emotionale Faktoren (Gefühle) spielen eine starke Rolle bei Wahlentscheidungen insbesondere hinsichtlich Risiko- und Verlustaversion.
Kapitel 11: Motivation
Motivation bezieht sich auf das aktive zielorientierte Ingangsetzen, Aufrechterhalten und Durchführen zumeist körperlicher aber auch psychischer Aktivitäten. Der Motivationsbegriff bezeichnet eine hypothetisch angenommene intervenierende Variable, die nur indirekt messbar ist an den Veränderungen der verschiedenen Ausgangsvariablen. Auch heute ist die Verwendung motivationaler Begriffe und Konzepte in der psychologischen Literatur noch keineswegs einheitlich und unterscheidet sich insbesondere nach unterschiedlichen Forschungsansätzen. Besprochen werden: - der instinkttheoretische und ethologische Ansatz - der psychoanalytisch- triebtheoretische Ansatz - die Behavioristisch-biopsychologischen Ansätze - die Kognitive und handlungstheoretische Ansätze. Als grundlegende Motivationen werden biologische Motivationen (Triebe) und psychologische Motivationen (Motive) unterschieden. Zu ersteren gehören homöostatische und nicht homöostatische Motivationen. Bei homöostatischen Motivationen wie Hunger oder Temperatur geht es um die Erreichung eines optimalen, entspannten Gleichgewichtszustandes, der nach dem Prinzip des geschlossenen Regelkreises mit entsprechender Rückmeldung angestrebt wird. Hunger und Sättigung werden im Hypothalamus gesteuert, wobei der ventromediale Hypothalamus für Sättigung, der laterale für vermehrtes „Fressverhalten“ zuständig ist. Hinzu kommen kognitive Umweltfaktoren, wobei Anreize der Umwelt (Geruch, Geschmack) im Vordergrund stehen (positive Anreiztheorie). Geschmackspräferenzen und Nahrungsaufnahme können und werden vermittels klassischer Konditionierung erlernt. Aber auch genetischen Faktoren kommt eine mitbestimmende Rolle bei der Setzung des Set-Points für Sättigung und für die Gewichtszunahme zu. Zu den nicht homöostatischen Motivationen gehören vor allem die sexuelle Motivation wie auch das Neugier Verhalten, als deren Ziel nicht Spannungsreduktion sondern vielmehr ein zunächst angenehmer Erregungszustand anzusehen ist. Sexualität kann eine unvergleichlich weite Spannbreite von Verhaltensweisen und Einstellungen motivieren. Sie gilt zugleich auch soziales Motiv das zu sozialen Gruppen und Verbindungen führt. Sexuelle Motivation wird weitgehend durch externe Reize aktiviert oder ausgelöst, daher auch als Anreizmotivation bezeichnet. Die sexuelle Differenzierung beginnt bereits im Mutterleib und ist die Grundlage für die erst später eintretende eigene Geschlechtsidentität. Die geschlechtliche Entwicklung wird bei beiden Geschlechtern in unterschiedlicher Weise von mehreren unterschiedlichen Hormonen gesteuert und führt in der Zeit der Pubertät zur Ausbildung der sekundären Geschlechtsmerkmale. Die sexuelle Erregung, die bei den meisten Tierarten jahresrhythmisch hormonell gesteuert wird, wird beim Menschen davon eher unabhängig vor allem durch erotische Reize hervorgerufen. Weiter wurden in diesem Kapitel der sexuelle Reaktionszyklus, der Einfluss von Erfahrung und kulturellen Bedingungen sowie die Bedeutung sexueller Skripts besprochen. Gesondert abgehandelt wurden physiologische und soziale Aspekte des Anschlussbedürfnisses und des Bindungsverhaltens. Neugier- und Explorationsverhalten W gilt als weiteres Handlung leitendes Motivthema, ist schon bei Kleinkindern zu beobachten und steht in positivem Zusammenhang mit der Entwicklungshöhe corticaler Funktionen. Unterschieden wird zwischen spezifischem (gerichteten) und diversivem Neugierverhalten. Hinzu kommen erst später die kognitiven Motivationsmodelle, die auch nicht biologische Bedürfnisse beschreiben. Während Murray eine lange Liste angenommener Grundbedürfnisse aufstellte ordnete Maslow die Menge möglicher Bedürfnisse in Form einer Hierarchie aufeinander aufbauender Bedürfnisse an, angefangen von den biologischen Grundbedürfnissen, nach deren Befriedigung aufsteigend weitere Bedürfnisse zum Tragen kommen können, wobei der zunächst letzten Stufe, der Selbstverwirklichung, eine besondere Bedeutung im menschlichen Leben beigemessen wird. Leistungsmotivation beschreibt das bei vielen Menschen auftretende Bedürfnis etwas zu leisten, woraus sich die Energie für das Ingangsetzen und Steuern vieler verschiedener Verhaltensweisen ableiten lässt. Der Stärke der Leistungsmotivation und ihrer Messbarkeit kommt in ihrer Auswirkung im praktischen Leben besondere Bedeutung zu. Menschen schreiben ihren Erfolgen und Misserfolgen in unterschiedlicher Weise Ursachen zu. Nach Atkinson lassen sich danach zumindest zwei Faktoren der Leistungsmotivation annehmen, das Bedürfnis nach Erfolg und die Angst vor Misserfolg. Entsprechend lassen sich erfolgsmotivierte und misserfolgsmotivierte (Angst vor Misserfolg) Personen und ihre Wahl leichter oder schwerer Aufgaben unterscheiden. Bei der Machtmotivation, dem Streben nach Dominanz, Einfluss und Kontrolle, bedarf es bestimmter Machtquellen, auf die sich die Macht stützt. Unterschieden werden derzeit sechs Machtquellen: Belohnungs- und Bestrafungsmacht sowie legitimierte und Informationsmacht sowie Vorbild und Expertenmacht. Zur Messung des Machtmotivs wurde ausgehend vom projektiven TAT, der auch zur Messung des Leistungsmotivs verwendet wird, ein vereinfachtes Gitterverfahren. Unterschieden wird die personalisierte Macht von der sozialisierten Macht. Nach physiologischen Untersuchungen ist das Dominanzstreben bei Säugetieren wie auch beim Menschen mit einer verstärkten Testosteronausschüttung verbunden, die möglicherweise mit positiven Affekten verbunden als belohnend empfunden wird. Motivation durch Zielsetzung. Ein weiterer wesentlicher Anreiz zu motiviertem Handeln ist das eigene Setzen von Zielen. Ein Ziel ist ein mentalrepräsentierter wertgeladener zukünftiger Zustand, der Verhalten steuert und organisiert. Ziele verändern unbeabsichtigt Aufmerksamkeits-, Gedächtnis- und Bewusstseinsprozesse (auf ein Ziel hin), und das zumeist unbewusst. Volition bezeichnet die Verwirklichung von Zielen und ist von Prozessen der Zielsetzung zu unterscheiden. Sie bezieht sich also auf das Streben nach, und die handelnde Umsetzung von, bereits gesetzten Zielen. Attributionstheorien basieren auf der Erkenntnis, dass Menschen sich normalerweise nicht damit begnügen, Ereignisse ihrer Umwelt, aber auch des eigenen Verhaltens, lediglich zu registrieren, sondern bestrebt sind, diese Ereignisse auf bestimmte Ursachen zurückzuführen. Hierbei lassen sich vier „Ursachenfaktoren“ unterscheiden, die ihrerseits entweder „zeitstabil“ oder über die Zeit „variabel“ sind und die wir gemäß unserer persönlichen Kontrollüberzeugung (locusof- control-Orientierung) entweder uns selbst zuschreiben (internal attribuieren) oder aber der Umwelt zuschreiben (external attribuieren). Dabei neigen Menschen generell eher dazu, Erfolge internal und Misserfolge external zu attribuieren. In diesem Zusammenhang werden Selbstwirksamkeit und Attributionsstile besprochen, ferner die Wirksamkeit von intrinsischer Motivation gegenüber extrinsischer, nicht aus der Sache selbst stammender, Motivation.
Kapitel 12: Emotion
Emotionen werden in uns gewöhnlich durch eine äußere Reizsituation und deren kognitiven Gehalt ausgelöst. Funktionale Bedeutung haben Emotionen im Zusammenhang mit Motivation durch ihre Handlung steuernde Wirkung über das Lust-Unlust Erleben. Emotionen und Motivation sind nur bedingt voneinander abgrenzbar. Emotionen sind eine „bewegende Erfahrung“. Sie zeigen sich als eine Reaktion des ganzen Organismus. Diese umfasst (1) physiologische Erregung, (2) bewusstes kognitives Erleben und (3) Ausdrucksverhalten. Auf der physiologischen Ebene werden über das sympathische Nervensystem verschiedene körperlich Veränderungen ausgelöst. Besprochen werden die Wirkung von Stress und Dauerstress sowie Langeweile auch auf das Gelingen guter Leistungen. Neuere emotionstheoretische Ansätze bevorzugen eine systemtheoretische Perspektive, bei welcher die verschiedenen einzelnen Komponenten einer Emotion als Miteinander in reziproker Wechselwirkung stehen. Besprochen werden verschiedene Theorien der Emotion. Nach der James-Lange-Theorie ist das beobachtbare emotionale Verhalten (z. B. Weinen) den anderen emotionalen Prozessen (z. B. sich traurig fühlen) vorgeordnet. Nach der Cannon-Bard-Theorie aktiviert die emotionsauslösende Reizsituation den Cortex und die körperlichen Reaktionen gleichzeitig, sodass diese auch gleichzeitig ablaufen. Nach Lindsleys Aktivationstheorie kommt der Formatio reticularis eine große Bedeutung als Steuerzentrum der Emotion zu. In diesem Zusammenhang wird die Bedeutung physiologisch unterschiedlicher Erregung auf das Emotionserleben diskutiert. Kognition und Emotion. Sensorische Wahrnehmungen und physiologische Erregungen führen nur dann zu Emotionen, wenn wir die Reize für uns in bestimmter Weise als persönlich bedeutsam einschätzen. Dazu wird die Zwei-Faktoren-Theorie von Schachter diskutiert. Je nach kognitiver Interpretation der Situation kann derselbe physiologische Erregungszustand einmal als die eine, im anderen Fall als eine völlig andere Emotion erlebt werden. Umgekehrt geht eine zweite Gruppe von Bewertungstheorien davon aus, dass unsere Bewertung einer äußeren Situation zu dem subjektiven Erleben einer Emotion und der damit verbundenen Erregung führt. Dagegen steht die Auffassung von Zajonc, dass der Emotionsprozess und die Verhaltensreaktion unter den meisten Umständen zu schnell ablaufen, als dass vorher noch genügend kognitive Aktivität stattfinden könne. Ergebnisse aus der Hirnforschung sprechen offenbar dafür, dass wir sogar kognitiv nicht erkannte und somit auch kognitiv nicht bewertete Reize emotional als angenehm oder unangenehm erleben (unbewusste Bewertung). Der emotionale Ausdruck hat, wie dargelegt wird, mehrere Funktionen: Er ist sozialkommunikativ, er dient der Regulation emotionaler Zustände, er unterstützt das emotionale Erlebnis oder kann es auslösen. Besprochen werden die Universalität des Ausdrucks und seine kommunikative Funktion, die Ausdruckslokalisationen in der rechten Hirnhemisphäre, sowie die Wirkungen des emotionalen Gesichtsausdrucks auf die erlebte Emotion (Facial-Feedback-Hypothese). Diskutiert wird, wie weit Aggression als emotionale Reaktion zu verstehen ist. Dabei werden die Mechanismen der Aggression besprochen. Drohverhalten als Aggressionsbereitschaft; Aggression als Folge erlebter Frustration, wie es die Frustrations-Aggressions-Theorie ausführt; Aggression als Folge erlebter Konditionierung nach dem lernpsychologischen Modell der Aggressionsentstehung; Aggression als genetisch angelegte Verhaltensdisposition im Rahmen sozialer Rangordnungen. Aggressive Emotionen lassen sich durch elektrische Hirnstimulation auslösen oder durch Pharmaka manipulieren. Auch gewalttätiges Verhalten kann so ausgelöst werden. Es wird wesentlich von den Mandelkernen im Gehirn gesteuert. Als weitere emotionale Reaktion werden die Entstehung von Angst und ihre biologische Grundlage besprochen. Aus biologischer Sicht spricht vieles dafür, dass wir bereits mit prädisponierten Ängsten bestimmten Gefahrenquellen geboren werden. Andererseits können wir Menschen vor fast allem Angst entwickeln. Angst ist auch klassisch konditionierbar oder kann durch Imitationslernen übernommen werden. Entstehung und Wirkung von emotionalem Stress werden erörtert. Stress wird verstanden als ein Reaktionsmuster des Organismus auf noxische (schädigende) physische oder psychische Reizereignisse, die seine Bewältigungsfähigkeiten übermäßig belasten oder überschreiten. Dabei gibt es große individuelle Unterschiede hinsichtlich Stresstoleranzen, wie auch unterschiedliche Bewältigungsstrategien (Coping). Für das Auftreten und die Art der Stressreaktion spielt die kognitive Bewertung des Stressors (oder der Situation) und der eigenen Ressourcen eine zentrale Rolle. Es werden verschiedene Konzepte der Stressverarbeitung vorgestellt. Diese läuft auf verschiedenen Ebenen ab: (1) auf der biologisch- physiologischen, (2) der emotional-erlebnismäßigen, (3) der psychologisch intraindividuellen und kognitiven und (4) auf der soziokulturellen Ebene. Es werden problemzentrierte und emotionszentrierte Strategien besprochen. Hinzu kommen die weitgehend unbewusst ablaufenden Abwehrmechanismen des Ich.